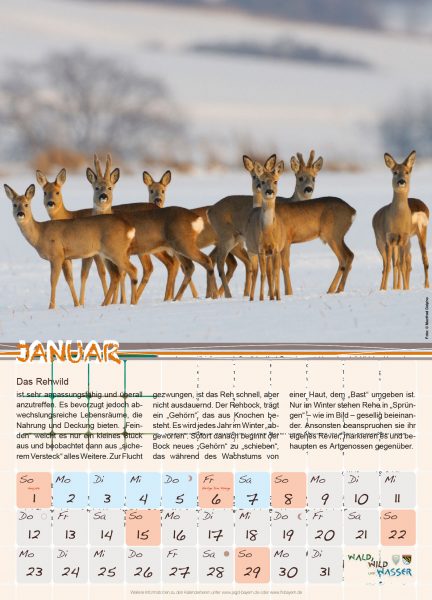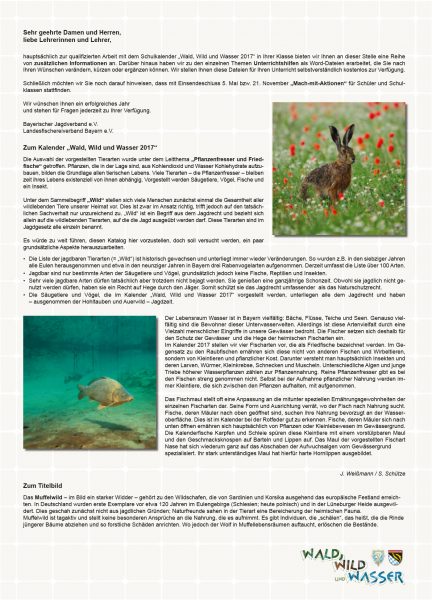Der Landesfischereiverband Bayern e.V. und die Bayerische Fischerjugend laden alle Fischer und Nichtfischer herzlich nach München ins Deutsche Jagd- und Fischereimuseum ein, um mit uns den Landesfischereitag 2016 zu erleben.
Das diesjährige Motto lautet: „Klimawandel – unsere Fische bekommen ihn schon zu spüren“. Hierzu diskutieren Fachleute in einer Podiumsdiskussion die Auswirkungen des Klimawandels auf Gewässerökologie und Fische.
Erstmalig wird der Preis unseres Wettbewerbs für Bayerns besten Fischereiverein vergeben. Die jeweiligen Gewinner in den drei Kategorien erhalten ihre Preise von Präsident Prof. Dr.-Ing. Albert Göttle, dem Schirmherren, Staatsminister Helmut Brunner und Vertretern der Sponsoren.
Das VereinsForum bietet Infostände, Experten-Vorträge und Workshops.
Vor dem Deutschen Jagd- und Fischereimuseum erleben Sie unser Großaquarium mit Hecht und Zander. Die Bayerische Fischerjugend zeigt jede Menge Knowhow für Jugendgruppen und Jungfischer. Für die Kleinen gibt es Kleinlebewesen, Aquarien und eine Malecke!
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.
DAS PROGRAMM AUF EINEN BLICK
Bayerisches Königsfischen
7.00 – 11.00 Uhr Königsfischen am Regattaparksee in Oberschleißheim
Festakt
13.30 – 15.00 Uhr Festakt mit Proklamation der Bayerischen Fischerkönige
LFV-VereinsForum
10.00 – 13.00 Uhr Infostände zur modernen Gewässerbewirtschaftung, Fischerprüfung, Gewässer und Artenschutzprojekte, Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit, Hotspot Projekt
„Alpenflusslandschaften“, Infos unserer Partner u.v.m.
10.00 – 10.45 Podiumsdiskussion Was macht das Klima mit den Fischen?
11.30 – 12.15 Uhr Preisverleihung „Bayerns Bester Fischereiverein“
Vorträge
11.00 – 11.30 Uhr Klimawandel und Besatz
12.30 – 13.00 Uhr Steuerrecht
Tag der Fischerjugend
Ganztägiges Angebot in der Fischereiabteilung des Museums
10.00 – 15.00 Uhr Infostand, Quizrally mit Preisen, Fischer machen Schule,
Fliegenbinden
Vorträge
11.00 Uhr Fische verwerten mit der Jugendgruppe
12.00 Uhr Neozoen und Neophyten – Gefahr für die Jugend?
Tipps und Tricks vom Jungfischerkönig
13.00 Uhr Messer in der Jugendgruppe